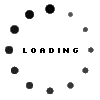Nicht nichts
ohne dich
aber nicht dasselbe
Nicht nichts
ohne dich
aber vielleicht weniger
Nicht nichts
aber weniger
und weniger
Vielleicht nicht nichts
ohne dich
aber nicht mehr viel
Erich Fried
Worte, die von grossem Verlust sprechen – und vom Verschwinden. Doch was macht man, wenn man selbst und alles um einen herum immer kleiner wird, immer dünner, immer durchsichtiger? Dieser Frage widmet sich Til Schweiger in seinem neuesten Film «Lieber Kurt», der auf dem (fast) gleichnamigen Roman von Sarah Kuttner basiert.
Das Gedicht, mit dem das Buch «Kurt» beginnt – und das auch im Film von Til Schweiger vorkommt –, versetzt den Leser sogleich in die richtige Stimmung. Man spürt, diese Geschichte handelt vom Verlieren, aber auch vom Zurückbleiben. Und tatsächlich, der Leser behält recht. Einige Seiten später stirbt der kleine Kurt. Er fällt vom Klettergerüst. Unspektakulär, leise, unauffällig. Tot. Die Folgen sind jedoch umso heftiger. Wie eine monströse Welle bricht die Trauer über die Hinterbliebenen herein. Über den Vater, den erwachsenen Kurt; die Mutter, Kurts Exfrau Jana; über Lena, Kurts Freundin. Die Welle umschliesst die Trauernden, verschluckt sie in ihrer Masse und wirbelt sie herum in ihrem nassen Magen … um sie dann schlussendlich auszuspeien wie ein Kind, das die ausgelutschten Kirschensteine in den Nachbargarten spuckt. Da wären wir also schon beim Hauptthema des Buchs «Kurt» und des Films «Lieber Kurt»: Der Trauer.
Til Schweiger ist es ausserordentlich gut gelungen, diese in seinem Film authentisch darzustellen; nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur. Es geht nicht (oder nur ganz kurz) um die Trauer, die weint und klagt. Es geht um die Trauer, die einen Gemeinheiten an seine Nächsten austeilen lässt; bei der man sich volllaufen lässt, bis man das Bewusstsein verliert; die einen schreien lässt: Leck mich am Arsch, ich trauere! Und dann geht es um die unendlich schwere Trauer, die einen langsam erdrückt, bis man immer kleiner wird, immer dünner. Durchsichtig. Denn wer ist man denn noch, wenn einem das Leben die wichtigste Rolle überhaupt, nämlich die des Vaterseins, raubt?
Auch seine Freundin Lena fühlt sich von diesem Gefühl des Verschwindens bedroht. Sie befindet sich im stetigen Rollenkonflikt zwischen der Trösterin, die dem trauernden Vater beizustehen versucht, und der Nicht-Mutter, die ebenfalls einen schweren Verlust erlebt hat. Ihre ursprüngliche Rolle als Kurts Geliebte und Partnerin schwindet immer mehr dahin … bis Lena sich selbst fast völlig aufgibt. Kurts Vater warnt sie einmal mit den Worten: «Überleben ist eine egoistische Sache.» Worauf Lena die fast schon kitschige Antwort bereithält: «Bei uns nicht, wir überleben zusammen.»
Überhaupt gibt es im Film viele dieser kitschigen Szenen, die teilweise fast schon übertrieben wirken – sei es aufgrund der Dialoge oder der Mise en Scène. Man kann sich daran stören – oder sich fragen, ob Til Schweiger das nicht mit Absicht gemacht hat: vor Kitsch triefende Liebe, Treueschwüre, Leidenschaft und märchenhafte Vater-Sohn-Szenen in von der Sonne geküssten Weizenfeldern. Der Zuschauer wiegt sich in falscher Sicherheit, belächelt die aufgeblasene Romantisierung fast schon – um dann von der Tragik ganz unvorbereitet getroffen zu werden. Besonders deutlich spürt man das zu Beginn des Films. Kurz nachdem sich Til Schweiger und Franziska Machens als Kurt und Lena die Liebe schwören, albernd durchs Haus rennen und sich neckisch mit dem Pinsel die Nase bemalen, überfällt einen das Unheil ganz unverhofft von hinten: Der kleine Kurt spielt auf dem Klettergerüst. Der Zuschauer sieht, wie die kleinen Kinderhände das Gerüst loslassen. Plumps. Und ein Kinderleben ist ausgelöscht.
Vielleicht wirkt das Wechselspiel zwischen pastöser Romantik und tonloser Tragik für die einen etwas widersprüchlich, aber kohärenter könnte es nicht sein: Es ist wie Til Schweiger selbst, etwas uneben eben. Til Schweiger ist ja bekannt für seine etwas freche Art, die hie und da ein bisschen unverblümt daherkommt. Zu wenig Feinheit werfen ihm die einen vor, den ewig Pubertären wurde er von anderen genannt. Dabei tut einem doch in der aufgepumpten, gestreckten, gelifteten, gekünstelten, gespielten Welt der Filmstars mal etwas Echtheit ganz gut. Til Schweiger ist eben mehr Sein als Schein – so scheint es jedenfalls. Überprüfen werden wir das gleich selbst. Wir haben den Schauspieler im Rahmen des Zürcher Filmfestivals zum Interview getroffen und uns kurz mit ihm unterhalten – über die Urangst eines Vaters, Juliette Binoche und darüber, wieso er von sich in der dritten Person spricht.
«No idea is final.» Wenn Sie den Film «Lieber Kurt» nochmals drehen könnten, würden Sie etwas anders machen?
Es is’ ja noch nicht so lange her, dass ich den gedreht habe. Es war letzten Sommer. Manchmal gibt es Filme, die ich mir im Abstand von zehn Jahren nochmals ansehe und bei denen ich dann denke: «Das würdest du heute anders machen … oder sogar ganz anders.» Aber meistens ist es so, dass ich mir denke: «Doch, doch, kann man so machen.» Kurt würde ich wieder genauso drehen.
Juliette Binoche sagte mal, dass man manchmal die «Wahrheit des Moments» verliere, also weniger authentisch spiele, wenn man dem Regisseur zu sehr gefallen will. Da Sie ja nun beide Rollen übernehmen, die des Schauspielers und die des Regisseurs, ist Ihr Schauspiel dadurch freier, echter geworden?
Nein, ich versuche immer so frei und so authentisch wie möglich zu sein. Nur Text lernen ist jetzt einfacher geworden, weil ich ihn ja selbst geschrieben habe – also zusammen mit Vanessa Walder. Ich stelle mir dann einfach vor, ich bin jetzt Kurt – oder Bernd oder so. Und ich spiel auch nicht, um dem Regisseur zu gefallen.
Wenn man sein eigener Regisseur ist, dann hat man ja plötzlich niemanden mehr, der einem auf die Finger schaut. Wie machen Sie das? Oder schauen Sie sich selbst auf die Finger?
Doch. Wir haben ja alles aufgezeichnet und da machen wir danach immer sofort ein Rückspiel. Da sag ich dann mir selbst jeweils: «Til, das hast du gut gemacht» oder «Til, das geht noch besser». Das mach ich übrigens auch bei allen andern, mit denen ich spiele. Wenn ich mit meiner Partnerin spiele, dann kann ich ja nicht gleichzeitig Regie machen. Sie braucht mich als echten Kurt und ich brauch sie als echte Lena. Danach gucke ich es bei ihr genauso gut an wie bei mir. Da kann ich sehr gut abstrahieren. Da seh ich dann wirklich den Kurt, also den Schauspieler, der Kurt spielt – und nicht mich. Auch im Schneideraum spreche ich immer von mir in der dritten Person. Da sag ich dann nicht «Ich schneide mir was weg», sondern «Dem da schneid ich was weg».
Hat Sarah Kuttner, die Autorin des Romans «Kurt», Ihnen zumindest noch ein wenig über die Schultern geschaut?
Sarah hat sich aus dem Dreh komplett rausgehalten. «Ich habe das Buch geschrieben, ihr macht jetzt den Film. Das ist dein Baby», hat sie gesagt. Sie hat uns einmal am Set besucht, dann erst an der Premiere wieder.
Der geheime Star des Films: Levi Wolter. Sein Schauspiel war ausserordentlich authentisch und berührte die Zuschauer. Wie unterscheidet sich die Arbeit mit einem Kind von derjenigen mit einem Erwachsenen?
Ich könnte jetzt meine verschiedenen Leistungen hervorheben … aber meine Hauptleistung bestand darin, ihn auszusuchen. Ich hab mir über 50 Kinder angeguckt – und hätte mir auch nochmals 150 Kinder angeguckt – wenn ich keinen gefunden hätte. Aber als Levi zum Casting kam, war es gleich klar: Der is’ es.
Der Unterschied vom Kind zum Erwachsenen ist, dass Kinder halt nicht genau gleich funktionieren wie Erwachsene, weil sie eben Kinder sind. Sie sind nicht so konzentriert. Aber das weiss man ja vorher. Ich habe selbst vier Kinder und hab auch viel mit denen gespielt. Und wenn die Kinder dann auf einmal keine Lust mehr hatten, dann war das halt so, dann musste man drauf reagieren. Levi ist zum Beispiel jemand, der hört so gut wie gar nicht zu. Und ich so: «Hallo, ich bin dein Regisseur … Hör mir mal zu. Ich rede mit dir!»
Aber was er dann schlussendlich macht, ist halt einfach grossartig! Im Endeffekt ist die Aufgabe eines Regisseurs bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, ihnen ein Umfeld zu schaffen von Vertrauen, Liebe, Selbstbewusstsein. Denn erst, wenn du dich sicher fühlst und beschützt wirst – auch Schutz ist nämlich ganz wichtig – und du durchaus auch mal scheisse spielen darfst, ohne dass dich jemand gleich anschreit, kannst du richtig entspannen. Und Entspannung ist die Grundlage für jedes Schauspiel.
Durfte denn Levi eine eigene Interpretation einbringen?
Nee, nee. Aber er ist halt einfach er. Das sagt man ja auch bei Erwachsenen: Der spielt ja nur sich selbst. Das is’ unbewusst das grösste Kompliment, das du einem machen kannst, weil dann ist man eben authentisch. Und er war eben authentisch: Levi war der kleine Kurt.
Sie haben es ja bereits erwähnt, Sie haben selbst vier Kinder. Ein Kind zu verlieren gehört wohl zur Urangst aller Väter. Haben Sie dieses Buch für den Film ausgesucht, weil Sie sich darin wiedergefunden haben?
Ich habe das gemacht, weil ich den Roman gelesen habe. Und der hat mich halt so bewegt – und das sicherlich wegen meiner Urangst mit vier Kindern. Ich glaube, er hätte mich auch bewegt, wenn ich keine Kinder gehabt hätte. Aber so natürlich noch mehr. Und so einen Film hatte ich noch nie gesehen, also wollte ich versuchen, ob man daraus einen Film machen kann. Das war nämlich gar nicht so einfach, denn die Romanvorlage besteht eigentlich nur aus Gedanken. Der Roman wird ja aus der Perspektive der Nicht-Mutter, also der Freundin des Vaters, der sein Kind verliert, erzählt. Das muss man erst mal in Dialoge packen. Ich habe den Film aber nicht gemacht, um mich meiner Urangst zu stellen. Ich mach Filme nicht, um mich selbst zu therapieren – ich mach sie für das Publikum. Das ist ein ergreifendes Thema, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann… darüber kann man einen Film machen. Man muss nicht immer nur Comedys machen oder Horrorfilme. Es gibt Regisseure, die machen ihr ganzes Leben lang nur Horrorfilme. Wenn sie damit glücklich werden, fein. Aber ich möchte halt versuchen, mit meinen Filmen in erster Linie zu unterhalten, aber eben auch Emotionen wecken. Und das tut der Film. Wer bei diesem Film keine Emotionen verspürt, der hat ein Herz aus Stein.
Die Trauer in Ihrem Film hat so gar nichts Lehrmeisterhaftes an sich. Es war sehr echt, wie der Vater getrauert hat. Man darf mal betrunken sein und ausrasten, man darf mal fies zur Partnerin sein. Wie ist Ihnen diese Authentizität so gut gelungen?
Ich habe eben versucht, so echt wie möglich zu spielen. Das heisst, es war ja nicht gespielt, ich war ja in dem Moment wirklich der Kurt. Und das machst du eben mit deiner Fantasie.
…
So, jetzt geht’s erst mal eine Zigarette rauchen. Und weg is’ er.