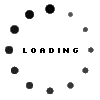Von Paris nach Mailand, über Mexiko und Tokio und wieder zurück. Die Orte, an denen Studioforma ihre Projekte realisiert, sind so unterschiedlich wie die Projekte selbst. So zum Beispiel der Hublot Tower in der Hauptstadt Japans, den Alex Leuzinger und sein Team letztes Jahr fertiggestellt haben. Ein Gespräch mit dem Inhaber des Zürcher Architektur- und Designstudios über die Durchmischung in Städten, die Andersartigkeit der Metropolen und welche grossen Veränderungen uns in Zukunft erwarten – oder eben nicht.
Frank Joss: Corona und dann? Wie stellen Sie sich die Zukunft nach Corona vor?
Alex Leuzinger: Es gibt zwei Szenarien für mich. Das ideale Szenario, das ich mir wünsche: Nach Corona wird alles anders sein. Die Leute haben eine andere Wahrnehmung, werden sensibler, offener. Das zweite Szenario: Es geht genau gleich weiter wie bisher. Ich glaube, das zweite trifft ein. Vielleicht wird es weniger Büroflächen in den Städten geben, aber dennoch brauchen wir sie. Wir haben es jetzt gesehen mit dem Homeoffice: Wir haben den Wunsch, andere Menschen zu treffen, uns auszutauschen. Zoom ist zwar gut, aber es fehlt der echte Kontakt, Mimik, Gestik.
Viele sagen, die Monokultur der Büros und Gewerbe sei mittlerweile tempi passati. Was glauben Sie?
Durchmischung bringt Leben. Wir haben bei Corona gesehen, dass einige Quartiere völlig ausgestorben waren. Die Läden gingen Konkurs, weil sie nur von den Mitarbeitern der Banken gelebt haben. Man muss eine gewisse Durchmischung hinkriegen, damit man nicht nur von einem Sektor abhängig ist. Nur so können wir eine Heterogenität in die Stadtstruktur hineinbringen.
Heterogenität scheint ja auch in Ihrem Büro eine wichtige Rolle zu spielen…
Genau, wir fahren nicht nur eingleisig. Da wir schon seit Jahren global tätig sind, haben wir auch einen breiteren Erfahrungsschatz, um Probleme zu lösen und auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Wir haben zudem Architekten verschiedener Nationalitäten bei uns und jeder bringt sein eigenes Knowhow und seine eigenen Visionen mit. Und bei uns gibt es keine festgesetzten Richtlinien. Wenn man beispielsweise zu einem Architekten wie Mario Botta geht, weiss man, jetzt kriege ich was mit roten Backsteinen. Wir sind da anders: Wir möchten die individuellen Träume des Kunden wahr werden lassen.
Und was braucht es für Sie, damit Sie sich an einem Ort wohlfühlen? Haben Sie eine Lieblingsstadt?
Paris. Mir gefällt die Mischung von kleinen und grösseren Läden. Die unglaublichen Gebäude, aber auch die kleinen Quartiere, die zum Verweilen einladen – man hat fast das Gefühl, man sei im Zürcher Niederdorf. Und das Bewusstsein für Schönheit fängt in Paris bereits beim Metzger an: Er gibt sich auf seine Art und Weise Mühe, sein Geschäft schön zu inszenieren. Dort hat man noch Wertschätzung für das Handwerk.
Haben Sie in Paris auch Objekte realisiert?
Ja, wir haben einiges gemacht, zum Beispiel beim Place Vendôme und an der Champs-Élysées. Die Durchmischung macht für mich diese Stadt aus. In Zürich fehlt das noch. Wir haben die Bahnhofstrasse, die tagsüber lebt, bis um halb sieben Uhr – danach ist sie wie ausgestorben. Im Niederdorf gibt es wiederum viele Restaurants, aber dafür fehlt es woanders. Da können nur die Behörden etwas bewirken, indem gewisse Gesetze geändert werden.
Gibt es etwas – trotz dieser immer grösser werdenden Zwänge des Gesetzes – bei dem die Stadt ihre Freiheit behalten muss?
Nehmen wir zum Beispiel die Begrenzung der Höhe: Der Schweizer hat sich noch nicht an sie gewöhnt. Alles, was mehr als vier Stockwerke hat, ist ein Schock für ihn. Da muss man dann Schattenstudien machen… Leute, die so denken, brauchen nicht in der Stadt zu wohnen. Wenn ich Vögel hören und Grün um mich herum haben will, dann gehe ich eben nach Gossau. Wenn ich in der Stadt wohnen will, dann wohne ich in der Stadt. Wenn wir hier ein bisschen mehr in die Höhe gehen, können wir dafür ausserhalb etwas mehr Grünfläche erhalten.
Zum Teil wird das ja schon gemacht, wie zum Beispiel in Zürich West.
Ja, nur leider gibt es da kein zusammenhängendes Konzept. Man tritt aus einem Gebäude heraus und steht im Niemandsland.
Und in welche Richtung sollte sich der Wohnungsbau in Zürich entwickeln? Es gibt ja den Trend des Wohn- und Arbeitsmix…
Zürich ist da ganz speziell. Es ist die Hochburg der unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten. Die Nachfrage nach gross und grösser steigt stetig. Man kann das nicht mit Paris oder Milano vergleichen. In solchen Grossstädten entstehen neue Visionen, neue Wohnformen.
Was sind das für neue Wohnformen?
Zusammen wohnen, zusammen arbeiten und wohnen, kleiner wohnen. Das entsteht aber eher aus der Not als aus Prinzip. Not macht kreativ. Hier sind wir in einer anderen Welt: Da setzt man sich an einen Tisch und entscheidet: «Wir bauen nun etwas Alternatives.» Wir geben viele Millionen für solche Gebäude aus – und leben in ihnen immer noch im Luxus. Das sind keine neuen Wohnformen, die natürlich von sich aus entstehen.
Paris, Milano, Tokio… Woher kommt es, dass Sie so oft international unterwegs sind?
Ich habe immer versucht, mich nicht auf etwas festzulegen. Ich wollte mich nie auf Umbauten, Neubauten oder Siedlungen spezialisieren, sondern immer neue Dinge entdecken und mich mit ihnen auseinandersetzen. Der Wunsch nach internationalen Aufträgen ist vor vielen Jahren entstanden, als man noch nicht so oft reisen konnte. Zudem faszinierte mich die Mode- und Luxuswelt der verschiedenen Grossstädte extrem. Wir Schweizer haben Glück, dass wir die Uhren- und Schmuckindustrie haben. Da habe ich angefangen zu arbeiten und ich fand es unheimlich spannend.
Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Wenn man als «kleiner Schweizer» nach Paris kommt und das Geschäft von Cartier einrichten will…
Ja, das war tatsächlich ein Kampf. Man kriegt da zu hören, dass man als Schweizer zwar genau und zuverlässig sei, es uns Schweizern aber an Fantasie und Kreativität fehle. Da muss man dranbleiben. Bei gewissen Kunden musste ich sechs Jahre warten, bis ich mal was machen durfte. Sobald man sich aber einmal bewiesen hat, wird es einfacher.
Was war das Eintrittsticket für die internationalen Aufträge?
Aufträge von Schweizer Uhrenmarken – wie zum Beispiel Hublot.
Zum Abschluss einige hypothetische und auch ganz persönliche Fragen. Herr Leuzinger, was bedeutet für Sie Zuhause?
Ich bin nicht ortsgebunden.
Es kann auch ein Gefühl sein.
Familie. Wenn meine Frau und Kinder um mich sind.
Was für sind für Sie Todsünden in der Architektur?
Fantasielosigkeit. Und wenn man Architektur zu seiner eigenen Selbstverwirklichung nutzt.
Wie wichtig ist Ihnen in diesem Zusammenhang der Genius Loci?
Heutzutage ist der total egal. Jeder baut für sich.
Das ist eine ehrliche Antwort. Welche Architekten haben Sie in Ihrem Schaffen denn am meisten geprägt?
Frank Lloyd Wright gefällt mir unglaublich gut. Und John Lautner, ein Schüler von Wright, ein Top-Architekt. Das Chemosphere-Haus in Los Angeles stammt von ihm. Seine Mischung von Materialien beeindruckt mich. Wenn man seine Gebäude betritt, ist es eine Entdeckungsreise – keine Anreihung von Räumlichkeiten. Und Alexis Dornier, er baut viel auf den Philippinen, macht alles aus Holz. Ihn habe ich über Instagram kennengelernt.
Die asiatische, vor allem die japanische Architektur, trägt ja auch eine gewisse Leichtigkeit in sich…
Genau. Auch für den Hublot Tower in Tokio haben wir uns daran orientiert. Bambus-Gerüste dienten uns als Inspiration für die Struktur. Dann kam uns die Idee mit den Lamellen. So entsteht der Eindruck einer gewissen Durchlässigkeit des Gebäudes. Die vielen Auflagen bezüglich der Erdbebensicherheit nahmen übrigens sehr viel Zeit in Anspruch. Die Planung dauerte mehrere Jahre.
Wir schreiben das Jahr 2050. Wie sieht die Architektur aus, in der wir leben?
Alle glauben immer an unglaubliche Zukunftstheorien. Wie in den 50er Jahren, als die Leute von Robotern und fliegenden Autos der Zukunft sprachen… Aber bei der ganzen Weiterentwicklung der Technologie, die derzeit stattfindet, gibt es eine Konstante: der Mensch. Wir sind genau gleich dumm – oder gescheit – wie die Menschen aus dem 16. Jahrhundert. Wenn ich jetzt ins Jahr 1520 reisen müsste… ich könnte nicht mal ein WC konstruieren, Licht machen oder Glas herstellen. Wir erwarten immer, dass alles schneller geht. Aber wir Menschen können gar nicht schneller werden. Darum: Wie es in 30 Jahren sein wird? Genau gleich wie heute.